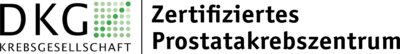BESTMÖGLICHE
DIAGNOSTIK
UND THERAPIE
BEI PROSTATA-
ERKRANKUNGEN
Das Prostata · Krebs · Centrum, Münster Süd

Im PKC am Herz-Jesu-Krankenhaus haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Patienten die bestmögliche Diagnostik und Therapie zuteilwerden zu lassen. Daher arbeiten wir fachübergreifend zusammen. Die Behandlung liegt nicht in der Hand eines einzigen Mediziners. Vielmehr kümmert sich ein interdisziplinäres Team von der Diagnose bis zur Nachsorge um jeden Patienten. Ein solches Team besteht aus Urologen, Strahlentherapeuten, Radiologen, Onkologen, Nuklearmedizinern und Pathologen. Von dieser Bündelung des Fachwissens profitieren Sie als Patient unmittelbar. Die enge Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialdienstes, Psychoonkologen, Seelsorgern und Selbsthilfegruppen erleichtert zusätzlich den Genesungsprozess.
Auf den folgenden Seiten finden Patienten, Angehörige, Interessierte sowie ärztliche Kollegen Informationen über die verschiedenen Erkrankungen der Prostata im Allgemeinen und über unsere diagnostischen und therapeutischen Methoden zur Behandlung von Prostatakrebs.
Sollten Sie Fragen haben, sind wir jederzeit gerne für Sie da.